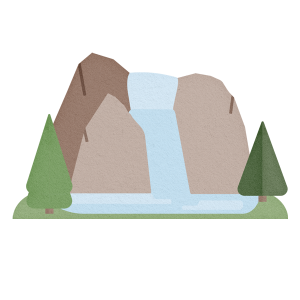Fließgewässer
Südtirol ist reich an Wasser. Jedes Jahr fallen große Mengen als Regen und Schnee auf unser Gebiet. Ein großer Teil davon fließt oberflächlich ab und bildet Bäche und Flüsse. Innerhalb des Biodiversitätsmonitorings untersuchen wir eine 120 Fließgewässerstandorte über Erhebungsperioden von jeweils vier Jahren. Jedes Jahr werden hierzu 24 Kontrollstandorte untersucht und zusätzlich 24 weitere Standorte. Dabei fokussieren wir uns auf die Erhebung von Larven verschiedener Insekten, wie Köcher- oder Eintagsfliegen, welche ihr Larvenstadium im Wasser verbringen. Daneben untersuchen wir auch abiotische Wasserparameter, wie verschiedene Nährstoffkonzentrationen, pH-Wert, Leitfähigkeit und Sauerstoffgehalt der jeweiligen Fließgewässer.
Weitgehend unterschiedliche topographische, geologische und klimatische Verhältnisse prägen die Fließgewässer Südtirols. Für das Biodiversitätsmonitoring wurden daher alle Fließgewässer in verschiedene Kategorien eingeteilt die sich unter anderem durch ihre Höhenlage, Abfluss und Geologie unterscheiden.